Helmut Schmidt und die Olympischen Spiele 2024: Jan Freitag widmet sich in seiner Kolumne diesmal dem Thema Abschied.
Der November, so heißt es, ist ein Monat des Abschieds. Abschied von der Hitze langer Tage, Abschied von der Wärme kurzer Nächte, Abschied vom Wesen aller Lebenslust gewissermaßen. Es sind vier schwindsüchtige Wochen mit erhöhter Suizid- und Depressionsgefahr, die sonntäglich Verblichene beweinen lassen: Heilige, Gefallene, den Tod im Ganzen. Da scheint es irgendwie einer höheren Macht zu gehorchen, dass im November gleich zwei Übergrößen hanseatischen Selbstverständnisses gestorben sind: Helmut Schmidt und die Olympischen Spiele. Genauer: die Illusion von beiden.
Denn thronte der Altbundeskanzler auch annähernd ein halbes Menschenleben nach der finalen Phase seiner politischen Macht noch wie ein Monarch über den Köpfen des führungsgierigen Volkes, so war der Plan, das weltgrößte Sportfest in knapp neun Jahren an Alster und Elbe zu feiern, nicht mehr als die Halluzination aktueller Bedeutsamkeit. Immerhin: Helmut Schmidt lebte, rauchte, dachte, dozierte, analysierte auch mit 96 Jahren wie einst zu Regierungszeiten, unbeirrbar und verehrt von (fast) allen. „Feuer und Flamme“ für Hamburg jedoch, dieser erfrischend anarchistische Slogan fürs staatstragende Ereignis in spe, war von Beginn an eine optische Täuschung, manifestiert auf Tausenden von Plakaten und einer medialen Berichterstattung im Rücken, die dem Begriff „Journalismus“ bis in seriöse Redaktionsetagen hinein spottete.
Was hätte Helmut Schmidt gesagt?
Helmut Schmidt, das andere Vexierbild Hamburger Bedeutsamkeit, hat sich dazu dem Vernehmen nach nicht allzu offen geäußert. Aber was hätte der Elder Statesman schon gesagt, in seiner schnodderig präsidialen, leicht altklugen, aber eben auch lebensweisen Art? „Nun kommt mal wieder runter von eurem hohen Ross“, vermutlich. Als unverwüstlicher Schiffermützenlotse liebte er seine Heimat schließlich viel zu sehr, um sie den Gernegrößen aus Wirtschaft, Politik und Presse zu überlassen. Er nahm sein Hamburg ja nicht viel wichtiger als es war, eben weil er es so mochte und umgekehrt, weil er alle Zuneigung mit Geschichte, Gegenwart und Zukunft abglich, weil er auch darüber sinnierte, Tag für Tag, Kippe für Kippe.
Das ist ein schöner, kluger, nostalgischer, intimer Patriotismus, lokal verwurzelt und polyglott. Der einzige womöglich, dem weder Selbstgerechtigkeit noch Ausgrenzung folgen, einer, für den man vielleicht zwei Kriege, vier Systeme, 24 Kanzler und bald 100 Jahre erlebt haben muss. Nun ist die rauchige, oft polarisierende, selten ungerechte Stimme pragmatischer Vernunft verstummt und fehlt selbst jenen, die ihn politisch kaum bewusst erlebt haben, was ein bisschen merkwürdig ist für einen, der ihm politisch noch nicht mal sonderlich nahe stand.
Wille, Demut, Kraft und Bescheidenheit
Vielleicht rührt dieses Verlustgefühl ja daher, dass Helmut Schmidt vier Führungseigenschaften miteinander verbunden hat, deren Kombination – falls es sie je großflächig gab – langsam auszusterben scheint: Wille und Demut, Kraft und Bescheidenheit. Alles versinnbildlicht in der wohl größten Absurdität seiner Amtszeit: Dass er bei alldem, worin dieser Staatsmann von Verachtung der Umweltschutzbewegung bis zur Ablehnung basisdemokratischer Teilhabe falsch lag, ausgerechnet den Tod des tiefbraunen Proletarierfressers Hanns-Martin Schleyers als eigenes Verschulden, mithin als persönlichen Verlust ansah.
Was muss dieser aufrechte Sozialdemokrat den reibungslos vom Helfershelfer des nationalsozialistischen Terrorregimes zum bundesrepublikanischen Arbeitgeberführer aufgestiegenen SS-Sturmbahnführer verachtet haben? Und doch erbot er ihm am Ende jenen Respekt, den die Täter-Generation Schleyer Andersdenkenden bis zur Vernichtung verweigert hatte. Es ist genau diese Größe, die Hamburg fortan fehlen wird, nicht die der elitären Sport- und Funktionärspaläste. Tschüss Helmut, Olympia Ade.










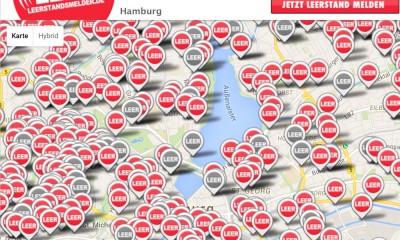
Facebook
Twitter
Flattr
Google+
YouTube
Soundcloud
Paypal
Anmelden